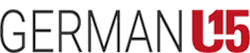Über die Autorin:
Henrike Üffing studiert am University College Freiburg im Bachelor Liberal Arts and Sciences. Das letzte Jahr hat sie in Kanada verbracht und nutzt auch sonst alle Gelegenheiten, zu reisen und den Blickwinkel zu ändern. Im Studium macht sie etwas mit Life Sciences, außerhalb gerne etwas mit Medien. Erste journalistische Erfahrungen hat sie bei UniCROSS und beim SWR gesammelt. Henrike mag Musik, Menschen und Flohmärkte.

Von Maschinen übers Leben lernen
Mächtige Codes, erdende Routinen und inspirierende Vorbilder – davon spricht Gresa Shala mit einer Euphorie, die die sonst ruhige Promovierende strahlen lässt. Künstliche Intelligenz (KI), speziell Meta-Learning, ist „das Ding, das mich ständig forschen lassen will“, so Gresa. In der Representation Learning Group der Universität Freiburg hat sie somit genau den richtigen Platz gefunden, um ihrem Forschungsdrang freien Lauf zu lassen. Im Gespräch darf ich hinter die coole Fassade einer Frau schauen, die dem Ruf der KI quer durch Europa gefolgt ist.
Aufgewachsen im Kosovo, war Gresa Shala schon als Kind neugierig – damals wollte sie noch Ärztin werden. Ihr Weg führte sie jedoch in die Welt der Informatik, und sie absolvierte in Pristina einen Bachelor in Computer Engineering. Über einen einmonatigen Besuch in einem Freiburger Forschungslabor lernte sie die Arbeit von Professor Frank Hutter kennen, der mit seinem Team zum sogenannten Machine Learning forscht. Gresa Shalas Interesse war geweckt, und sie bewarb sich auf einen forschungsintegrierten Master in Computer Science an der Universität Freiburg. Inzwischen ist sie inmitten ihres PhD-Programms, hat schon zwei Paper veröffentlicht und ist weiterhin von Freiburg und Forschung begeistert.
Dieser scheinbar geradlinige Weg hin zur Spitzenforschung war für Gresa nicht immer leicht – sie hat sich das Gefühl, in die männerdominierte IT-Branche zu gehören, erarbeitet. „Früher hatte ich viel mit Perfektionismus und Imposter-Syndrom zu kämpfen“, sagt Gresa und erkennt direkt an, dass die Zweifel durch Prägungen von außen kamen. „Wenn ich über meine eigenen Erfahrungen nachdenke, habe ich diese subtile Voreingenommenheit in Aktion beobachtet, die einen tief verwurzelten Unterschied in der Art und Weise, wie wir Leistungen aufgrund des Geschlechts anerkennen, hervorhebt.“ Es mache sie traurig, dass so viele junge Mädchen ihr Potential nicht ausschöpfen. Wer sie inspiriert hat: „Chelsea Finn, ohne Frage“, sagt Gresa und meint eine Stanford-Professorin, deren Arbeit ihr Interesse am Machine Learning ausgelöst hat. „Es bräuchte aber noch viel mehr weibliche Repräsentation im IT-Bereich“, ist sich Gresa sicher. Das würde „Girls in STEM“, also in naturwissenschaftlichen oder technischen Berufsfeldern, ermutigen.
Dass sie heute die strukturellen Ursachen ihrer Unsicherheiten versteht, hat sie einem Gender Studies Kurs in Freiburg zu verdanken. „Nicht deine Fähigkeiten hindern dich daran, Mathematikerin, Ärztin oder was immer du sein willst zu werden“, sagt sie. „Es sind gesellschaftliche Muster, die dich früh prägen, den Pfad deines Lebens beeinflussen und dich unterbewusst glauben lassen, du wärst für etwas anderes gemacht“.
Bei Gresa Shala hat der Hang zur Wissenschaft gesiegt. So kommt es, dass sie nun täglich – gerne nach einer Morgenrunde durch den Japanischen Garten am Seepark – an die Technische Fakultät fährt, wo ihr Forschungsalltag beginnt. Wie der genau aussieht? „Programmieren, und langweilige Grafiken anschauen“, lacht sie. Der Austausch mit dem Team sei auch wichtig. „Traut euch, eigene Ideen einzubringen!“, ist Gresas Message an jüngere Wissenschaftlerinnen. Bei genauerer Nachfrage wird klar, dass ihre Computercodes und Grafiken zwar hochkomplex, aber gar nicht so langweilig sind wie angeteasert.
„Lernen, wie man lernt“ – darum geht es beim Meta-Learning. Gresa Shala erklärt das so: „Als Babys sind wir alle sehr anpassungsfähig – mit sehr wenig Wissen eignen wir uns nach und nach kleine Aufgaben an und bauen so ein System von Wissen auf“. Während das im menschlichen Körper im Gehirn passiert, haben Maschinen analog dazu künstliche neuronale Netze. Wie die „Maschinen-Gehirne“ lernen und was dabei optimiert werden kann, kontrolliert Gresa als Programmiererin ähnlich wie eine Ärztin, die die Gehirnwellen ihrer Patienten misst. Falls dabei etwas schiefläuft, probiert Gresa eine neue Konfiguration aus, bis es funktioniert. „Dickköpfig sein hilft“, sagt sie und meint damit mehr als die IT-Arbeit an sich.
Was ihr auch hilft, ist Ausgleich. Die Doktorandin macht Yoga, Meditation und Sport. Der Umzug aus dem Kosovo war zu vorpandemischen Zeiten ein Erfolg, sie habe sich direkt im sonnigen Freiburg wohlgefühlt. „Als introvertierte Person finde ich immer einen Platz, an dem ich abschalten kann.“ Hat Gresa Lust, Freunde zu treffen, macht sie das am liebsten in der Altstadt. Zu ihrer Work-Life-Balance sagt sie: „Die Routine habe ich durch Trial-and-Error entwickelt, über Jahre hinweg“ – ganz die Programmiererin eben.