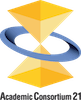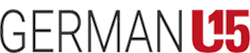Durch die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder soll der Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig gestärkt und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessert werden. Damit wird die bereits mit der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder initiierte Weiterentwicklung und Stärkung der deutschen Universitäten fortgeführt. Das Programm wird gemeinsam umgesetzt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Wissenschaftsrat (WR).
Das Programm umfasst die beiden Förderlinien Exzellenzcluster und Exzellenzuniversitäten und wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Website des Wissenschaftsrats (WR).
In der aktuell laufenden ersten Runde der Exzellenzstrategie ist die Universität Freiburg in der ersten Förderlinie mit den Exzellenzclustern CIBSS – Centre for Integrative Biological Signalling Studies und livMatS – Living, Adaptive and Energy-autonomous Materials Systems erfolgreich. Die beiden Exzellenzcluster haben zum 1. Januar 2019 ihre Arbeit aufgenommen.
Antragskizzen in der Förderlinie Exzellenzcluster der Exzellenzstrategie
In der aktuellen Wettbewerbsrunde der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder sind zwei Clusterinitiativen der Universität Freiburg einen wichtigen Schritt weitergekommen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und der Wissenschaftsrat haben die Freiburger Exzellenzclusterinitiativen Constitution as Practice in Times of Transformation (ConTrans) und Future Forests – Adapting Complex Social-ecological Forest Systems to Global Change zur Abgabe eines Vollantrags bis zum 22. August 2024 aufgefordert. Diesem Meilenstein geht ein gemeinsamer Prozess von Universitätsleitung und über 200 Wissenschaftler*innen voraus: Seit Februar 2021 ist die Beteiligung der Universität an der neuen Runde der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder in Vorbereitung, eingebettet in die gesamtuniversitäre Strategiebildung „Universität Freiburg 2030“.
Die bereits bestehenden Exzellenzcluster der Universität Freiburg, Centre for Integrative Biological Signalling Studies (CIBSS) und Living, Adaptive and Energy-autonomous Materials Systems (livMatS), werden Anträge für eine zweite Laufzeit einreichen.
Folgende Exzellenzclusterinitiativen werden Vollanträge einreichen:
Moderne Verfassungen stehen im Zentrum sozio-politischer Hoffnungen und Konflikte. Oftmals als Gründungsdokumente moderner Nationalstaaten verstanden, werden sie mit Dauer und Stabilität assoziiert. Will man jedoch die Grundordnungen von Gesellschaften und Gemeinschaften über Zeit und Raum hinweg verstehen, zeigen sich Grenzen des modernen Verfassungsverständnisses. Verfassungen beruhen auf sozialen Praktiken, die sie zu einem Faktor im Prozess der Anpassung von Gesellschaftsordnungen machen. Diese Dimension wird in Zeiten wirtschaftlicher, sozialer und politischer Veränderungen und Krisen besonders deutlich, ist jedoch bislang vernachlässigt worden. Daher bedarf es eines konsequent interdisziplinären Ansatzes.
ConTrans bringt hierfür erstmalig Perspektiven aus unterschiedlichsten Disziplinen – von der Rechtswissenschaft über die Geschichtswissenschaft bis hin zur Literaturwissenschaft und Psychologie – in einem umfassenden und langfristigen Versuch zusammen, Verfassungen als soziale Praktiken zu untersuchen. Nur so lassen sich Varianten von Verfasstheit über Raum und Zeit hinweg erfassen. Sie reichen von Symbolen, Ritualen und Verfahren bis hin zur diskursiven Funktion „antiker Verfassungen“ in modernen Auseinandersetzungen. Dies erfordert einen innovativen Analyserahmen, um kommunikative und institutionelle Praktiken unterschiedlicher Akteure zu erforschen.
Das Ziel der beteiligten Wissenschaftler*innen besteht darin, über ConTrans eine internationale und interdisziplinäre Verfassungsforschung im Verbund von Geistes- und Gesellschaftswissenschaften zu etablieren und in einem Freiburg Centre for Interdisciplinary Constitutional Studies (FreiCIC) sichtbar zu machen.
Beteiligte Fakultäten (in alphabetischer Reihenfolge): Philologische Fakultät, Philosophische Fakultät, Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Theologische Fakultät, Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät
Sprecher*innen: Prof. Dr. Matthias Jestaedt, Prof. Dr. Jörn Leonhard, Prof. Dr. Sitta von Reden

Prof. Dr. Matthias Jestaedt ist Professor für Öffentliches Recht und Rechtstheorie am Institut für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Dort ist er Direktor der Abteilung für Rechtstheorie. Er ist zudem internationaler Korrespondent des Hans Kelsen-Instituts Wien, seit 2012 auch Mitglied in dessen Vorstand. Er leitet die Hans-Kelsen-Forschungsstelle. Seit 2014 ist er Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Seine Forschungsschwerpunkte sind Verfassungsrecht und Verfassungsvergleichung, europäischer Menschenrechtsschutz, Staatskirchenrecht, Rechtstheorie und Rechtswissenschaftstheorie, Kinder- und Jugendhilferecht sowie Hans Kelsen. Er ist Mitglied der „GE-Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Erzdiözese Freiburg“.

Prof. Dr. Jörn Leonhard ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas am Historischen Seminar der Philosophischen Fakultät. Er war Gründungsdirektor der School of History des Freiburg Institute of Advanced Studies (FRIAS). Für seine Arbeiten wurde er unter anderem mit dem Landesforschungspreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Seine Schwerpunkte liegen in der vergleichenden europäischen und globalen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, insbesondere den Themen Krieg und Frieden, Gewalt und Politik sowie Empires und Nationalstaaten. Er ist unter anderem ordentliches Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Honorary Fellow am Wadham College der Universität Oxford sowie Mitglied in den Wissenschaftlichen Beiräten des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart und des Deutschen Historischen Instituts London. Er leitet derzeit das Forschungsprojekt „Die Krise der Welt, 1918-1941“, gefördert durch das Opus Magnum-Programm der Volkswagenstiftung.

Prof. Dr. Sitta von Reden ist Professorin für Alte Geschichte am Historischen Seminar der Philosophischen Fakultät. Sie lehrt zusätzlich am University College Freiburg und im Masterstudiengang Interdisziplinäre Anthropologie. Sie ist Projektleiterin des vom European Research Council mit einem ERC Advanced Grant geförderten Projekts „Beyond the Silk Road“. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören neben griechischer Geschichte die antike Wirtschafts- und Globalgeschichte, das hellenistische Ägypten und die politische Kultur Griechenlands und Athens sowie die vergleichende Geschichte antiker Imperien.
Wälder bedecken circa 30 Prozent der globalen Landfläche und erbringen zahlreiche, essentielle Ökosystemleistungen (ÖSL): Sie stellen erneuerbare Ressourcen bereit, reduzieren die Auswirkungen des Klimawandels, unterstützen die menschliche Gesundheit und bewahren die biologische Vielfalt. Angesichts des raschen Klimawandels, neuartiger Störungen und der Ansiedlung oder des Verlusts von Arten entwickeln sich große Teile der Wälder hin zu neuartigen Ökosystemen, die in der Evolutionsgeschichte keine Entsprechung haben. Es ist sehr ungewiss, inwieweit diese neuartigen Ökosysteme die gewünschten ÖSL erbringen und die biologische Vielfalt erhalten können. Veränderungen werden so schnell eintreten, dass natürliche Anpassungsprozesse zu langsam sind.
Parallel sind große gesellschaftliche Veränderungen zu erwarten, die sich aus Prozessen wie Urbanisierung, Globalisierung und Handel, Landnutzung sowie veränderten Ansprüchen in Bezug auf die Leistungen der Natur für den Menschen ergeben. Die natürliche und die soziale Sphäre sind eng miteinander verflochten, interagieren auf komplexe Weise und schaffen so unerwartete Risiken. Mit einem besseren Verständnis dieser Systemdynamik können Strategien entworfen werden, um unerwünschte Entwicklungen zu verhindern. Daher wollen die Forschenden von Future Forests neuartige Beiträge zur Konzeptualisierung und Analyse von Wäldern als neue sozial-ökologische Systeme (SÖS) leisten.
Die Ansätze von Future Forests zur Analyse und Entwicklung von Transformationslösungen für waldbasierte SÖS werden die Grundlage für anpassungsfähigere Waldsysteme und nachhaltigere Transformationslösungen als in der Vergangenheit bilden. Diese Ansätze werden auf andere Teile der Welt und ein breites Spektrum von Ökosystemleistungen übertragbar sein.
Beteiligte Fakultäten (in alphabetischer Reihenfolge): Fakultät für Biologie, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Medizinische Fakultät, Philosophische Fakultät
Sprecher*innen: Prof. Dr. Jürgen Bauhus, Prof. Dr. Friederike Lang, Prof. Dr. Marc Hanewinkel

Prof. Dr. Jürgen Bauhus leitet die Professur für Waldbau an der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit der Steuerung der Struktur und Dynamik von Wäldern für die Bereitstellung von Ökosystemleistungen, mit den Auswirkungen von waldbaulichen Maßnahmen auf das Ökosystem und die Anpassung von Wäldern an den globalen Wandel. Für seine Forschung erhielt er den „Scientific Achievement Award“ der International Union of Forest Research Organizations (IUFRO). Er ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Waldpolitik des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

Prof. Dr. Friederike Lang leitet die Professur für Bodenökologie, die am Institut für Forstwissenschaften der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen angesiedelt ist. Ihre Forschungsschwerpunkte ist die Kopplung von Kohlenstoff- und Nährstoffdynamik in Waldböden, Bodenschutz (Mechanisierte Forstwirtschaft), sowie die Ökologie der Bodenstruktur. Sie forscht derzeit unter anderem im Sonderforschungsbereich ECOSENSE (SFB 1537) zu skalenübergreifenden Quantifizierung von Ökosystemprozessen mittels smarter autonomer Sensornetzwerke und ist Sprecherin der Forschungsgruppe Forest Floor (FOR 5315). Sie ist Mitglied in der Kommission Bodenschutz im Umweltbundesamt und im Wissenschaftlichen Beirat für Waldpolitik des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

Prof. Dr. Marc Hanewinkel ist Professor für Forstökonomie und Forstplanung am Institut für Forstwissenschaften der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen. Er befasst sich unter anderem mit den Themen Risikoanalyse (Risikoerfassung, -modellierung und –bewertung), Auswirkungen des Klimawandels auf Wälder Europas, Entwicklung adaptiver Managementstrategien, ökonomische Analyse von Klimaänderungen, Bioenergie, Auswirkungen veränderter Waldbewirtschaftungsstrategien sowie den Waldumbau. Derzeit forscht er unter anderem in dem ClimXtreme Verbundprojekt Modul C Impacts – Teilprojekt 11: WIND – Auswirkungen von Winterstürmen in Mitteleuropa. Er ist Mitglied im europäischen Netzwerk für Forstwissenschaften NFZ.forestnet.
Rückblick
Erste Konzepte für mögliche Exzellenzclusterinitiativen wurden 2021 gemeinsam mit internen und externen Gutachter*innen begutachtet. Als Ergebnis bat die Universitätsleitung im Juli 2022 sieben Initiativen, ihre Konzepte weiterzuentwickeln.
In ihrer Gesamtheit spiegeln die sieben Exzellenzclusterinitiativen und die beiden geförderten Exzellenzcluster das Forschungsprofil und ausgewiesene Forschungsstärken der Universität wider: Alle elf Fakultäten sind an den stark interdisziplinär ausgerichteten Anträgen beteiligt.
Alle sieben Initiativen haben Antragskizzen eingereicht. Davon wurden zwei für eine weitere Runde berücksichtigt. Die Universität Freiburg ist von der Qualität aller Antragsskizzen überzeugt und wird sie in anderen Formaten weiterentwickeln.
Informationen zur Beteiligung der Universität Freiburg im Vorgängerprogramm, der Exzellenzinitiative, finden Sie im folgenden Rückblick:
Im Juni 2005 haben Bund und Länder das Programm der Exzellenzinitiative beschlossen – mit dem Ziel, den Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig zu stärken, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und Spitzen im Universitäts- und Wissenschaftsbereich auszubilden. Der Wettbewerb unter allen deutschen Universitäten fand zunächst in den drei Förderlinien Zukunftskonzepte, Exzellenzcluster und Graduiertenschulen statt, für die in zwei Förderphasen (2005-2012, 2010-2017) insgesamt 4,6 Milliarden Euro zur Verfügung standen.
In den beiden Runden der Exzellenzinitiative war die Universität Freiburg mit dem Cluster BIOSS – Centre for Biological Signalling Studies und der Spemann Graduiertenschule für Biologie und Medizin (SGBM) erfolgreich. In der zweiten Runde überzeugte sie darüber hinaus mit dem Cluster BrainLinks-BrainTools und in der ersten mit ihrem Zukunftskonzept, in dem ihr internationales Forschungskolleg Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) eine zentrale Stellung einnahm.

Spemann Graduiertenschule für Biologie und Medizin (SGBM)
Mit ihrem dynamischen, interdisziplinären Ausbildungsprogramm bereitet die Spemann Graduiertenschule für Biologie und Medizin (SGBM) Doktorandinnen und Doktoranden darauf vor, künftige wissenschaftliche Herausforderungen zu meistern. Ihr Anspruch ist es, erstklassige Lebenswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der Zukunft hervorzubringen, die Wissen und Technik aus unterschiedlichen Disziplinen ebenso miteinander verbinden können wie Grundlagenforschung und translationale Forschung, Biotechnologie und Arzneimittelentwicklung. Zur SGBM-Website
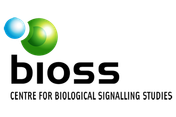
BIOSS – Centre for Biological Signalling Studies
Biologische Signalprozesse bilden die Lebensgrundlage aller Zellen eines Organismus. BIOSS – Centre for Biological Signalling Studies benutzt moderne analytische Methoden und Strategien der Synthetischen Biologie, um in kreativer und spielerischer Weise die komplexen Abläufe biologischer Signalprozesse zu verstehen und zu kontrollieren. Die zentrale Forschungsidee von BIOSS besteht darin, einen dialektischen Forschungsprozess zwischen analytisch und synthetisch arbeitenden Signalwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern zu initiieren sowie zu fördern. Zur BIOSS-Website

BrainLinks-BrainTools
BrainLinks-BrainTools vereint Lebens- und Ingenieurswissenschaften sowie ihre klinische Anwendung. Dadurch bildet die Neurotechnologie eine Forschungsachse zwischen drei Fakultäten der Universität – Biologie, Technik und Medizin – sowie mehreren Kooperationspartnern. Die gemeinsame Forschung und Lehre von Neuro- und Ingenieurswissenschaften erzielt neue, interdisziplinäre Ergebnisse in einem Bereich, der für die gesamte Gesellschaft von großer Bedeutung ist. Zur BrainLinks-BrainTools-Website

Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS)
Das Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) ist das internationale Forschungskolleg der Universität Freiburg. Als integraler Bestandteil der Universität vereint das Institut unter einem Dach Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Medizin, Lebens-, Natur- und Ingenieurwissenschaften. Führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie ausgezeichnete Nachwuchskräfte aus Freiburg und der ganzen Welt arbeiten am FRIAS, um sich für eine begrenzte Zeit voll auf ihr wissenschaftliches Projekt konzentrieren zu können. Auf diese Weise schafft das Institut neue Forschungsfreiräume innerhalb der Universität – für Individual- wie für Gruppenforschung. Zur FRIAS-Website