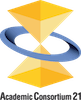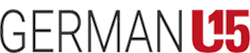Häufig gestellte Fragen von Mitarbeitenden
Corona-Tests
Die Universität bietet auf dem Universitätsgelände keine Testmöglichkeiten an und stellt auch keine SARS-CoV-2-Antigentests zur Selbstanwendung zur Verfügung. Es ist auch keine Bestellung mehr möglich.
Falls Sie sich testen lassen möchten haben Sie dieses eigenverantwortlich außerhalb der Dienstzeit durchzuführen. In der Regel ist hier ein Eigenanteil von 3 EUR zu zahlen. Eine Erstattung durch die Universität ist nicht möglich. Weitere Infos finden Sie hier.
Sollten Sie Symptome einer Coronavirus-Infektion haben bleiben Sie bitte zu Hause und lassen Sie sich telefonisch beraten (Hausarztpraxen, Fieberambulanzen, bundesweite Rufnummer des Kassenärztlichen Notdienstes in Deutschland 116117). Hier erfahren Sie, ob ein Test in Frage kommt und wo Sie ihn durchführen können.
Nein, es werden keine SARS-CoV-2-Antigentests zur Selbstanwendung zur Verfügung gestellt.
Impfung
Auf “Dranbleiben-BW.de” können Sie Informationen zum Thema Impfen, Hinweise zu Standorten und aktuelle Impf-Aktionen bei Ihnen vor Ort abrufen. Über dieses Portal können auch direkt Impftermine gebucht werden. Über den Betriebsärztlichen Dienst besteht derzeit kein Corona-Impfangebot.
Die Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 ist während der Arbeitszeit möglich. Bitte nutzen Sie dieses Angebot und lassen Sie sich impfen.
Arbeitszeit und -verträge, Urlaub, Homeoffice
Die Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 ist während der Arbeitszeit möglich. Bitte nutzen Sie dieses Angebot und lassen Sie sich impfen.
Für Tarifbeschäftigte
Mögliche Vertragsverlängerungen bei Corona auf Grund der Corona-bedingten Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
Mit dem Gesetz zur Unterstützung von Wissenschaft und Studierenden aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden unter anderem die Höchstbefristungsdauer bei Verträgen, die nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG befristet sind verlängert. Außerdem hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung durch Verordnung aktuell diese Zeiten um weitere sechs Monate verlängert.
Nach dem neuen § 7 Abs. 3 WissZeitVG und der Verordnung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zu diesem Paragraph besteht die Möglichkeit, dass sich die zulässige Befristungsdauer um 12 Monate verlängert, wenn ein Arbeitsverhältnis nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG zwischen dem 01. März 2020 und dem 30. September 2020 bestanden hat. Bei Beschäftigten deren Arbeitsverhältnis zwischen dem 01. Oktober 2020 und dem 31. März 2021 besteht, verlängert sich die zulässige Befristungsdauer max. sechs Monate.
Das bedeutet, dass sich die gesetzliche Höchstbefristungsdauer für Beschäftigte, die
- Zum Zeitpunkt zwischen dem 01. März 2020 und dem 30. September 2020
- Zu ihrer Qualifizierung nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG
befristet waren oder noch sind, um 12 Monate auf sechs Jahre und 12 Monate bzw. auf 12 Jahre und Monate verlängert und für Beschäftigte, die
- Zum Zeitpunkt zwischen dem 01. Oktober 2020 und dem 31. März 2021
- Zu ihrer Qualifizierung nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG
bei der Universität Freiburg beschäftigt sind, um sechs Monate auf sechs Jahre und sechs Monate bzw. auf 12 Jahre und sechs Monate verlängert.
Ein Anspruch auf eine Verlängerung oder eine automatische Verlängerung ist mit dieser Regelung nicht verbunden. Auf Antrag des*der zuständigen Vorgesetzten mit Angaben zur weiteren Finanzierung und mit Angaben welches Qualifizierungsziel erreicht werden soll, können je nach Einzelfall Verträge für bis zu 12 Monate bzw. bis zu sechs Monate (Arbeitsaufnahme zwischen dem 01.10.2020 und dem 31.03.2021) abgeschlossen werden, wenn dies erforderlich und angemessen ist. Bitte senden Sie in diesem Fall einen entsprechenden P6-Antrag an das Personaldezernat und fügen Sie noch eine kurze Stellungnahme zu dem Sachverhalt bei.
Für Beschäftigte, die nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG (Drittmittelbefristung) befristet beschäftigt sind gilt die hier aufgeführte Verlängerungsmöglichkeit nicht. Teilweise reagieren Drittmittelgeber auch mit Laufzeitverlängerungen, so das auch hier Verträge entsprechend verlängert werden können.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an den*die für sie zuständige*n Personalsachbearbeiter*in wenden.
Für Beamte
Corona-bedingte Änderung des Landeshochschulgesetzes
Verlängerung von Beamtenverhältnissen auf Zeit auf Antrag aufgrund von pandemiebedingten Verzögerungen in der Weiterqualifizierung
Nach einer neu geschaffenen Regelung im Landeshochschulgesetz (LHG) können Beamtenverhältnisse auf Zeit von Akademischen Rät*innen und Juniorprofessor*innen, die schon zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. März 2021 bestanden haben, gemäß § 45 Abs. 6a LHG auf Antrag um bis zu zwölf Monate verlängert werden, um damit pandemiebedingte Behinderungen und Verzögerungen in der Weiterqualifizierung auszugleichen.
Wichtig: diese Verlängerungsmöglichkeit wurde nun von bis zu sechs Monaten auf bis zu zwölf Monate erhöht.
Ein Anspruch auf eine Verlängerung oder ein Automatismus ist mit dieser Regelung jedoch nicht verbunden, es handelt sich vielmehr um eine Ermessensentscheidung der Universität.
Die Verlängerung muss schriftlich formlos über den Dienstweg durch den*die Beamt*in unter Angabe der beabsichtigten Verlängerungsdauer (bis zu zwölf Monate) beantragt werden. In diesem Antrag sollte nachvollziehbar dargelegt und begründet werden, weshalb es in der persönlichen Weiterqualifizierung zu Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie kam. Dieser Antrag muss dann mit einer ergänzenden, unterstützenden Stellungnahme des*der direkten Vorgesetzten und der Zustimmung des*der Dekan*in der jeweiligen Fakultät beim Personaldezernat eingereicht werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihre*n zuständige*n Personalsachbearbeiter*in.
Für Beamt*innen sowie für Arbeitnehmer*innen gilt die Verordnung zum Schutz vor einreisebedingten Infektionsgefahren in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Einreiseverordnung-CoronaEinreiseV) des Bundes in der jeweils geltenden Fassung.
Sollte nach dem Urlaub eine Quarantäne erforderlich sein, erfolgt keine bezahlte Freistellung. Die Notwendigkeit der Reise und das jeweilige Risiko sollten verantwortungsvoll abgewogen werden.
Das Sommersemester 2022 ist ein Semester der Präsenz. Dieses erfordert auch eine vermehrte Präsenz der Beschäftigten.
Für Arbeiten im Homeoffice gelten ab dem 28. Mai 2022 die Regelungen der bestehenden Dienstvereinbarung zu „Tele- Und Heimarbeit an der Universität Freiburg“ (siehe unter Service A-Z – Mobiles Arbeiten und Homeoffice). Anträge von Beschäftigten auf Homeoffice nach der o.g. Dienstvereinbarung können unter Verwendung des Formulars P500 gestellt werden.
Es gilt folgende Übergangsfrist: Beschäftigte, die bis zum 5. Juni 2022 einen Antrag mit dem Formular P 500 stellen, können bis zu dessen Bescheidung in dem im Antrag angegebenen Umfang im Homeoffice arbeiten. Vorgesetzte werden gebeten, Anträge unverzüglich an das Personaldezernat weiterzuleiten.
Beschäftigten, die nach der vom Ausschuss für Arbeitsmedizin herausgegebenen arbeitsmedizinischen Empfehlung „Umgang mit aufgrund der SARS-CoV-2-Epidemie besonders schutzbedürftigen Beschäftigten“ besonders zu schützen sind, ist weiterhin Homeoffice im vereinfachten Verfahren zu gewähren. Zu dieser Gruppe gehören insbesondere Beschäftigte, die sich dauerhaft einer Therapie mit Immunsuppresiva unterziehen müssen oder sich einer Organ- oder Stammzelltransplantation unterziehen mussten sowie Beschäftigte mit Malignom-Anamnese unter laufender Therapie, Beschäftigte mit Herzinsuffizienz ab NYHA III-Klassifikation, mit Kardiomyopathien ab NYHA III oder mit höhergradigen Herzklappendefekten.
Soweit möglich, sind Räume, die durch Teilzeitbeschäftigungen oder Urlaub zeitweise nicht belegt sind, temporär zur Kontaktreduktion durch andere Beschäftigte zu nutzen. Die zeitweilige Nutzung eines anderen Arbeitsplatzes ist mit den Mitarbeitenden vorher abzustimmen.
Die Universität ermöglicht allen Beschäftigten zur Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres bis auf Weiteres Telearbeit oder mobiles Arbeiten, wenn eine andere geeignete Person zur Betreuung nicht zur Verfügung steht und zwingende betriebliche Gründe dem nicht entgegenstehen.
Tarifbeschäftigte
Darüber hinaus besteht für die Tarifbeschäftigten unter den folgenden Voraussetzungen ein Anspruch auf Kinderkrankengeld.
Voraussetzungen für die Gewährung von Kinderkrankengeld nach § 45 SGBV
Kinderkrankengeld können Tarifbeschäftigte erhalten, die in einer gesetzlichen Krankenkasse gesetzlich oder freiwillig versichert sind und deren Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, weil
- die Betreuungseinrichtung behördlich geschlossen wurde
- Ihr Kind die Betreuungseinrichtung nicht betreten darf
- die Präsenzpflicht in der Schule aufgehoben wurde
- es beim Zugang zum Betreuungsangebot Einschränkungen gibt
- es eine behördliche Empfehlung gibt, vom Besuch der Einrichtung abzusehen.
Gesetzlich versicherte Eltern können im Jahr 2022 pro Kind und Elternteil 30 statt 10 Tage Kinderkrankengeld beantragen, insgesamt bei mehreren Kindern maximal 65 Tage. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch von 20 auf 60 Tage pro Kind und Elternteil, maximal bei mehreren Kindern auf 130 Tage.
Falls Sie Kinderkrankengeld beantragen möchten, müssen Sie bei der Krankenkasse einen entsprechenden Antrag stellen und dort auch ggf. eine entsprechende Bescheinigung der Schule oder Kita einreichen (abhängig von Ihrer Krankenkasse). Bitte teilen Sie dann die Tage, für die Sie Kinderkrankengeld beantragt haben, der* dem zuständigen Sachbearbeiter*in im Personaldezernat per E-Mail mit. Das Personaldezernat meldet dann diese Tage beim Landesamt für Besoldung und Versorgung. Dort wird dann die Gehaltszahlung für diese Tage eingestellt.
Das Kinderkrankengeld beträgt 90 % Ihres ausgefallenen Nettoentgelts. Es gibt eine tägliche Höchstgrenze für das Kinderkrankengeld. Sie liegt bei 112,88 Euro pro Tag. In der Zeit, in der ohnehin Schulen oder Betreuungseinrichtungen geschlossen sind (reguläre Schul- oder Kitaferien), besteht der Anspruch nicht.
Anspruch auf Entschädigungszahlung
Neben dem Anspruch auf Kinderkrankengeld haben alle Tarifbeschäftigte gemäß §56 Abs. 1a Infektionsschutzgesetz einen Anspruch auf Entschädigungszahlung bis zum 23.09.2022, wobei Sie entweder nur Kinderkrankengeld beantragen können oder Ihren Anspruch nach dem Infektionsschutzgesetz geltend machen können. Einen Anspruch nach dem Infektionsschutzgesetz haben auch Tarifbeschäftigte, die keinen Anspruch auf Kinderkrankengeld haben und die Ihr Kind, das unter 12 Jahre alt ist, zu Hause betreuen müssen. Bei gemeinsamer Betreuung erhalten Eltern eine Entschädigung unabhängig von der Anzahl der Kinder für bis zu zehn Wochen pro Jahr, bei alleiniger Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege bis zu 20 Wochen pro Jahr.
Falls Sie Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz beantragen möchten, ist zu beachten, dass vorrangig ein positives Arbeitszeitguthaben oder Alturlaub in Anspruch zu nehmen ist. Ein Anspruch nach dem Infektionsschutzgesetz besteht während den regulären Schul- oder Kitaferien.
Beamtinnen und Beamte
Für Beamtinnen und Beamte, die ein Kind, das das 12. LJ. noch nicht vollendet hat betreuen müssen finden weder die Regelung nach § 45 SGB V noch die Regelung nach § 56 Abs. 1a IfSG für Tarifbeschäftigte unmittelbare Anwendung.
In sinngemäßer Anwendung können auch Beamt*innen, die ihr Kind aufgrund einer behördlichen Schließung oder bei einem Betretungsverbot einer Betreuungseinrichtung o.ä. von zuhause betreuen müssen (siehe dazu die oben aufgeführten Voraussetzungen bei den Tarifbeschäftigten) pro Kind 18 Arbeitstage, jedoch nicht mehr als 36 Tage bei mehreren Kindern ( § 29 Abs. 1 Nr. 1 AzUVO). Alleinerziehende haben die Möglichkeit bis zu 18 Arbeitstagen, bzw. bei mehreren Kindern bis zu 36 Arbeitstage im Kalenderjahr 2022 zu beantragen. Für das Kalenderjahr 2022 gilt dies jedoch bis September 2022.
Die weiteren Kinderkranktage für die Kinderbetreuung bei einer Schließung oder bei einem Betretungsverbot einer Betreuungseinrichtung u.ä. können nicht für die Zeit, in der ohnehin Schulen oder Betreuungseinrichtungen geschlossen sind (reguläre Schul- oder Kitaferien), in Anspruch genommen werden.
Zudem kann der Dienstvorgesetzte, aufgrund der Übertragungen der Wertungen des § 56 Abs. 1a IfSG im Falle der behördlichen Schließung von Einrichtungen oder bei einem Betretungsverbot der Betreuungseinrichtung weiteren Sonderurlaub gewähren, wenn dienstlich Gründe nicht dagegenstehen.
Vorrangig muss in diesen Fällen positives Arbeitszeitguthaben und Alturlaub in Anspruch genommen werden. Soweit dienstlich möglich kann Telearbeit (es gilt die Dienstvereinbarung zur „Tele- und Heimarbeit“ an der Universität Freiburg) genutzt werden.
Werden diese weiteren Kinderkranktage für die Betreuung eines kranken Kindes in Anspruch genommen, reduziert sich deren Anzahl entsprechend für die Inanspruchnahme zur Kinderbetreuung bei einer Schließung oder bei einem Betretungsverbot einer Betreuungseinrichtung u.ä.. Dies gilt für das Kalenderjahr 2022 ab dem 1. Januar 2022 bis zum Ablauf des 23. September 2022.
In jedem Fall muss in diesen Fällen mit dem*der zuständigen Sachbearbeiter*in im Personaldezernat Kontakt aufgenommen und die weitere Vorgehensweise geklärt werden.
Arbeitnehmer*innen, die aufgrund der Schließung einer voll- oder teilstationären Pflegeeinrichtung die Betreuung von nahen, pflegebedürften Angehörigen übernehmen müssen, haben keinen Anspruch auf Kinderkrankengeld.
Es besteht aber ein Anspruch auf eine Entschädigungszahlung nach § 56 Abs. 1a lfSG bis zum 23.09.2022. Bevor dieser Entschädigungsanspruch geltend gemacht werden kann, sind vorrangig positive Arbeitszeitguthaben und Alturlaub in Anspruch zu nehmen. Für die Zeiten, in denen Betreuungseinrichtungen geschlossen sind (reguläre Ferien), ist keine Entschädigung vorgesehen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte, an den*die für Sie zuständige*n Sachbearbeiter*in beim Personaldezernat.
Beamtinnen und Beamte dürfen weiterhin bis zu zehn Arbeitstagen, davon neun Arbeitstage unter Belassung der Bezüge in Anspruch nehmen, wenn dies erforderlich ist, um für pflegebedürftige nahe Angehörige in einer akuten Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege sicherzustellen (§ 74 Abs. 1 LBG). Weitere neun Arbeitstage Sonderurlaub sind möglich bis zum 31. Juni 2022, wenn eine akut auftretende Pflegesituation auf Grund COVID-19 vorliegt und die bedarfsgerechte Pflege zu organisieren ist und die Pflege in dieser Zeit nicht anderweitig gewährleistet werden kann. Insgesamt darf die Anzahl der Inanspruchnahme von Akut-Pflegetagen 20 Arbeitstage, davon 18 Arbeitstage mit Bezügen, nicht überschreiten.
Bitte wenden Sie sich auch hier bei Fragen an den*die für Sie zuständige*n Sachbearbeiter*in beim Personaldezernat.
Uni-Kitas
Tarifbeschäftigte
Die Universität bietet den Tarifbeschäftigten zur Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres bis auf Weiteres Telearbeit oder mobiles Arbeiten an, wenn eine andere geeignete Person zur Betreuung nicht zur Verfügung steht. Zwingende betriebsbedingte Gründe dürfen dem nicht entgegenstehen.
Darüber hinaus besteht unter den folgenden Voraussetzungen ein Anspruch auf Kinderkrankengeld oder eine Entschädigungszahlung nach Infektionsschutzgesetz.
Voraussetzungen für die Gewährung von Kinderkrankengeld nach § 45 SGB V
Kinderkrankengeld können Tarifbeschäftigte erhalten, die in einer gesetzlichen Krankenkasse gesetzlich oder freiwillig versichert sind und deren Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, weil
- Die Betreuungseinrichtung behördlich geschlossen wurde
- Ihr Kind die Betreuungseinrichtung nicht betreten darf
- Die Präsenzpflicht in der Schule aufgehoben wurde
- es beim Zugang zum Betreuungsangebot Einschränkungen gibt
- es eine behördliche Empfehlung gibt, vom Besuch der Einrichtung abzusehen.
Gesetzlich versicherte Eltern können im Jahr 2022 pro Kind und Elternteil 30 statt 10 Tage Kinderkrankengeld beantragen, insgesamt bei mehreren Kindern maximal 60 Tage. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch von 20 auf 60 Tage pro Kind und Elternteil, maximal bei mehreren Kindern auf 130 Tage.
Der Betreuungsbedarf muss gegenüber der Krankenkasse durch eine entsprechende Bescheinigung nachgewiesen werden. Bei der Krankenkasse müssen Sie auch einen Antrag auf das Kinderkrankengeld einreichen. Sie müssen dann die Tage, für die sie Kinderkrankengeld beantragt haben, der*dem zuständigen Sachbearbeiter*in im Personaldezernat mitteilen und uns auch eine Kopie der Bescheinigung von der Kita oder Schule vorlegen. Das Personaldezernat meldet dann diese Tage beim Landesamt für Besoldung und Versorgung und dort wird dann die Gehaltszahlung für diese Tage eingestellt.
Das Kinderkrankengeld beträgt 90 % Ihres ausgefallenen Nettoentgelts. Es gibt eine tägliche Höchstgrenze für das Kinderkrankengeld. Sie liegt bei 112,88 Euro pro Tag.
Neben dem Anspruch auf Kinderkrankengeld haben alle Tarifbeschäftigte auch einen Anspruch auf Entschädigungszahlung nach dem Infektionsschutzgesetz, wobei Sie entweder nur Kinderkrankengeld beantragen können oder Ihren Anspruch nach dem Infektionsschutzgesetz geltend machen können. Einen Anspruch nach dem Infektionsschutzgesetz haben auch Tarifbeschäftigte, die keinen Anspruch auf Kinderkrankengeld haben und die Ihr Kind, das unter 12 Jahre alt ist, zu Hause betreuen müssen.
Falls Sie Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz beantragen möchten, ist zu beachten dass die Möglichkeiten zur Telearbeit und mobiles Arbeiten, soweit dienstlich möglich, vorrangig zu nutzen sind. Ebenso sind vorrangig ein positives Arbeitszeitguthaben oder Alturlaub in Anspruch zu nehmen. Ein Anspruch nach dem Infektionsschutzgesetz besteht auch nicht, wenn eine Notbetreuung an der Schule oder der Kita besteht oder während den regulären Schul- oder Kitaferien.
Bei Fragen, wenden Sie sich rechtzeitig, an den*die für Sie zuständigen Sachbearbeiter*in.
Beamtinnen und Beamte
Auch Beamtinnen und Beamte haben die Möglichkeit Telearbeit an der Universität Freiburg zu nutzen. Grundlage ist hier die aktuell bestehende Dienstvereinbarung zur „Tele- und Heimarbeit“ an der Universität Freiburg .
Für Beamtinnen und Beamte, die ein Kind, das das 12. LJ. noch nicht vollendet hat betreuen müssen findet weder die Regelung nach § 45 SGB V noch die Regelung nach § 56 Abs. 1a IfSG unmittelbare Anwendung.
In sinngemäßer Anwendung können auch Beamt*innen, die ihr Kind aufgrund einer behördlichen Schließung oder bei einem Betretungsverbot einer Betreuungseinrichtung o.ä. von zuhause betreuen müssen (siehe dazu die oben aufgeführten Voraussetzungen bei den Tarifbeschäftigten) pro Kind 9 Tage, bei mehreren Kindern maximal 18 Tage Sonderurlaub gewährt werden (§ 29 Abs. 1 Nr. 1 AzUVO). Alleinerziehende haben die Möglichkeit bis zu 18 Arbeitstage, bzw. mehr mehreren Kindern bis zu 36 Arbeitstage imKalenderjahr 2022 zu beantragen. Für das Kalenderjahr 2022 gilt dies jedoch nur bis zum Ablauf des 23. Septembers 2022.
Voraussetzung hierfür ist nicht, dass vorrangig Telearbeit, positives Zeitguthaben oder Alturlaub oder eine alternative zumutbare Betreuung (z.B. Notbetreuung in der Schule oder Betreuungseinrichtung) in Anspruch genommen werden muss.
Zudem kann der Dienstvorgesetzte, aufgrund der Übertragungen der Wertungen des § 56 Abs. 1a IfSG im Falle der behördlichen Schließung von Einrichtungen oder bei einem Betretungsverbot der Betreuungseinrichtung weiteren Sonderurlaub gewähren, wenn dienstlich Gründe nicht dagegenstehen.
Vorrangig muss hier, soweit dienstlich möglich Telearbeit genutzt werden. Ebenfalls vorrangig muss in diesen Fällen positives Arbeitszeitguthaben und Alturlaub in Anspruch genommen werden.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an den*die für Sie zuständige*n Sachbearbeiter*in im Personaldezernat.
- Antrag auf Teilnahme an Telearbeit (schriftlicher Antrag)
- Dokumentation von Arbeitszeiten (Tabelle 2023).